 | 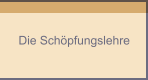 |  |


Die Notwendigkeit, einer wissenschaftlichen Überprüfung der Evolutionstheorie Gehör zu verschaffen, zeigte sich besonders in jüngster Zeit: Aus Anlass des 150. Jahrestages der Veröffentlichung von Darwins Werk „Über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der vollkommensten Rassen im Kampf ums Dasein” wurden zahlreiche Wortmeldungen veröffentlicht, die von der „Tatsache der Evolution“ sprechen.
Oft werden als Haupt-Belege für Evolution die populationsgenetischen Befunde im Bereich der Rassenbildung (Darwinfinken, Birkenspanner, etc.) oder der Resistenzbildung (Bakterien, Gräser etc.) angeführt.
Diese Phänomene stellen aber bei genauerer Betrachtung keine echten Beweise für eine natürliche Zunahme genetischer Information dar. Das Gegenteil ist vielmehr der Fall: Populationen umfassen typischerweise ein breit verteiltes Merkmalsspektrum an individuellen Variationen eines gemeinsamen Grundaufbaus. Durch natürliche oder künstliche Isolation bzw. Selektion von Teilpopulationen mit Genen, die in der ausgewählten Untermenge seltener vorkommen als in der Gesamtmenge, lassen sich neue Rassen oder Arten bilden. Diese können sich etwa durch Form, Farbe oder Empfindlichkeit auf Giftstoffe von dem durchschnittlichen Profil unterscheiden. Das liegt aber nur daran, dass die genetische Vielfalt durch die Isolierung in dieser Teilgruppe abgenommen hat. Bereits vorher vorhandene genetische Information wurde durch das Ausblenden eines bestimmten Teils der Gen-Mannigfaltigkeit angereichert. Solche Isolationsprozesse führen jedoch keinesfalls zur postulierten Evolution völlig neuer Gene mit spezifischer Komplexität. Alles, was wir bei der Rassen- und Resistenzbildung beobachten können - und genau im Beobachten besteht Naturwissenschaft - ist nicht Evolution sondern Devolution.
Diese Fakten widersprechen der Darstellung zahlreicher aktueller Veröffentlichungen, in denen anhand von horizontalen Variationen auf dem selben Komplexitätsniveau gefolgert wird, man hätte eine echte vertikale Evolution gefunden.
Ferner ist bedeutsam, dass man nirgends in der jetzigen Natur und in den Fossilien auch nur ein einziges halbfertiges Organ sehen kann, das erkennbar irgendwohin evolviert, das heißt komplexer wird: Entweder ein Organ ist vollständig ausgebildet oder gar nicht vorhanden. Man beobachtet also den „Fittesten“ und gleichzeitig den „Unfittesten“ einer vermeintlichen Entwicklungskette. Die Zwischenwesen wären aber alle überlebenstauglicher gewesen als letzterer. Deshalb müssten wir neben diesem auch solche Halbfertigen noch heute beobachten, was nicht der Fall ist.
Der Grund für die vollständige Abwesenheit von Evolution in der jetzigen Natur und den Fossilien liegt im Grundgesetz der materiellen Welt, dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik. Dieser beschreibt unsere gewöhnliche Alltagserfahrung, dass sich materielle Strukuren immer in Richtung größerer Wahrscheinlichkeit, d. h. Unordnung entwickeln und niemals umgekehrt. Die Entropie muss stets zunehmen, was für einen hypothetischen Evolutionsprozess eine unüberbrückbare Barriere darstellt. Bisweilen wird in diesem Zusammenhang als Einwand z. B. die Bildung von geordneten Kristallstrukturen bei Ausfuhr von Wärmeenergie, etwa von Schneeflocken aus Wassermolekülen, angeführt. Dies seien Beispiele dafür, dass bei sogenannten „offenen Systemen“ (solchen, die Energie- und Teilchenaustausch mit der Umgebung erlauben) neue, unwahrscheinliche Ordnung tatsächlich von selbst entstehen könne. Doch in Wirklichkeit sind die beobachtbaren Symmetrien des Kristalls bereits vorher in der Symmetrie der zugrundeliegenden Moleküle vorhanden gewesen. Es entsteht also auch in offenen Systemen keine neuartige Information. Die scheinbar „selbst-organisierte“ Ordnung spiegelt lediglich die bereits atomar vorprogrammierte Ordnung wider. Das selbe gilt für die Entstehung von Polymeren oder "dissipativen Strukturen". Biologische Strukturen sind jedoch im Gegensatz dazu neue, in keiner Weise bereits irgendwo vorhandene spezifisch komplexe Ordnung. Deshalb können sie auch in offenen Systemen nicht durch physikalische Prozesse, d. h. durch Evolution, erzeugt werden.
Ein einzelner Mutations-Selektions-Schritt auf dem selben Komplexitätsniveau verletzt zwar das Entropie-Gesetz nicht, auch nicht die Aneinanderreihung von vielen Tausenden solcher Veränderungen, die jeweils den Informationsgehalt nicht erhöhen. Die Verletzung liegt jedoch darin, dass nur ganz bestimmte solcher Schritte aneinandergereiht werden dürfen, wenn am Ende ein neues Organ erzeugt werden soll. Dass nach jedem Evolutions-Schritt aus allen möglichen weiteren hypothetischen Evolutionsrichtungen immer nur diejenige zufällig die überlebensgünstigste wäre, die dann am Ende zur Entstehung einer neuen funktionalen Struktur führt, ist statistisch ausgeschlossen. An Tausenden von Abzweigungen gibt es zahlreiche konstruktive Sackgassen, die - obwohl aktueller Weg größter Fitness - nicht in Richtung eines komplexen Zielorgans führen. Mit andern Worten: Am Fittesten zu sein und zu neuem Organ zu führen sind nicht das selbe. Nur das erstere könnte Selektion sehen, das letztere nicht.
-------------------------------------------------------------
Beweis gegen die Evolutionstheorie:
Die Schönheit und Vollständigkeit der Geschöpfe |
Zusammenstellung naturwissenschaftlicher Argumente
Broschüre mit naturwissenschaftlichen Argumenten (englisch)
Online-Präsentation theologischer und naturwissenschaftlicher Argumente
Die schnelle Bildung von Sedimentschichten
Evolutionskritische Konferenz in römischer Universität
Daylightorigins (irisch)
Centre d'Études et de Prospective sur la Science (französisch)
---------------------------------------------------
Kontakt: Thomas.H.Seiler@web.de





